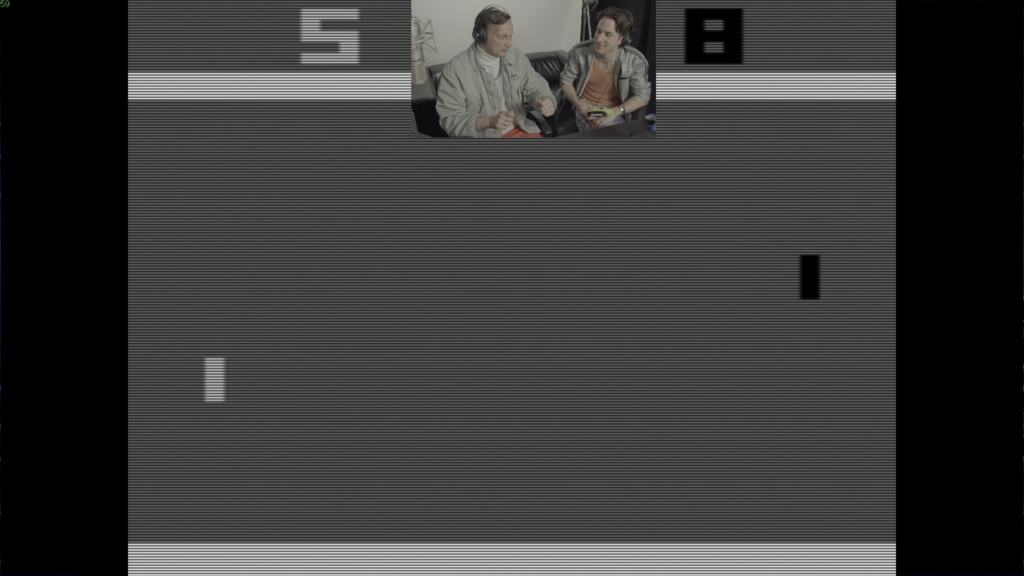Die Geschichte um eine Nachrichtensprecherin (Raphaela Crossey) und ihre Familie – Papa ein alternder Schauspieler (Wolfram Boelzle) sowie die gelangweilte Teenie-Tochter Ilvy (Esther Hilsemer) – im spirituellen Griechenlandurlaub, entpuppt sich als andeutungsweise Persiflage auf ungefähr alles. Das klingt unspezifisch. Ist es auch. Neben einer halbherzigen Karl-Lauterbach-Parodie des Kölners (!) Marcel Hoffmann werden Sitcom-Formate, Sci-fi-Serien und Fridays-for-Future kalauerhaft eingeworfen.
Eine rechte Regierung durch die fiktive Partei “der Flügel” unter einem gar nicht so fiktiven Kanzler Höcke und den Ministern Gau und Land gibt es auch und irgendwann fallen alle mal Ethylen-high in eine delphinische Erdspalte. Wie im Rausch soll wohl die angekündigte Seitwärtsbewegung auf dem Zeitstrahl wirken, die Protagonisten und Zuschauer nun gleichsam erleben. Das immerhin ist nachvollziehbar, wirkt es doch ähnlich wirr wie die mäandernden Aussagen des sagenumwobenen Orakels.
Überhaupt wird unglaublich viel monologisiert und das zudem zu laut von einem – in so einem kleinen Theater wirklich überflüssig – mikrofonierten Ensemble. Wer immer grad nicht im Zeitloch verweilt, hat die Bühne für sich und nutzt das Rampenlicht schamlos aus um dystopische, aber vertraute, Zukunftsbilder zu entwickeln. Es geht um die Klimakrise (nicht mehr zu stoppen), den Rechtsruck (schon passiert), die Überbevölkerung (lieber Eisbären gebären als Menschen) und die Sinnlosigkeit des Kapitalismus (eh klar). Originelle Ideen sucht man vergeblich, Tiefgang auch. Der wird spätestens durch die Sitcom-Ästhetik der weiteren Zukunftsszenen verhindert. Besonders der Beitrag zur Gender-Debatte, wirft Fragen auf. Viel zu unironisch und irgendwie befremdlich wirkt schon der Kommentar zur Niederkunft der jungen Ilvy, die statt eines Kindes einen Eisbären zur Welt bringt. Dazu heißt es von einer anderen Rolle sinngemäß, das sei eigentlich egal, gäbe es doch mindestens 60 Geschlechter, warum dann nicht auch einen Eisbären. Noch deutlicher wird das ungute Gefühl, dass eine echte Auseinandersetzung mit der komplexen Gender-Debatte nicht stattfindet, wenn man Versicherungsagent*in Michelle betrachtet. Die genderfluide Rolle ist erst Mann, dann Frau, dann Meerjungfrau und zum Schluss, im Jenseits, Das konservierte Bewusstsein eines Cis-Mannes, das behauptet schon immer ein Mann gewesen zu sein und sich nur der Mode nach angepasst zu haben. Vermutlich – hoffentlich – ist das ironisch gemeint. Da die Aussage völlig unkommentiert bleibt, kommt das jedoch nicht an und ist so eine bloße Reproduktion des Alltagssexismus, mit dem sich Transmenschen tagtäglich auseinandersetzen müssen. Erschütternd.
Einziger Lichtblick sind die – aus unerfindlichen Gründen eingeworfen – Opernarien, die Mezzosopranistin Danielle Rohr zuvor mit dem Hausorchester aufgenommen hat. Weshalb sie nun im dunkelgrünen Abendkleid, rauchend und stumm auf der Bühne stehen kann, während Ton und Bildaufnahmen im Gegenschnitt mit von Flutwellen zerstörten Landschaften über große Leinwände flackern. Das lässt erahnen: auch die Ausstattung von Dorit Lievenbrück (Bühne) und Bernhard Hülfenhaus (Kostüme) bedient sich einiger Klischees. Die gefallen trotzdem zeitweise, z.B. wenn die 80er-Jahre in der Ausstattung einer Sience-Fiction-Show lebendig werden oder ein klassisches Diner-Restaurant depressiv-nostalgisch im hinteren Bühnendrittel schwebt, erinnert aber bisweilen auch an das bunte Potpourri einer Karnevalssitzung.